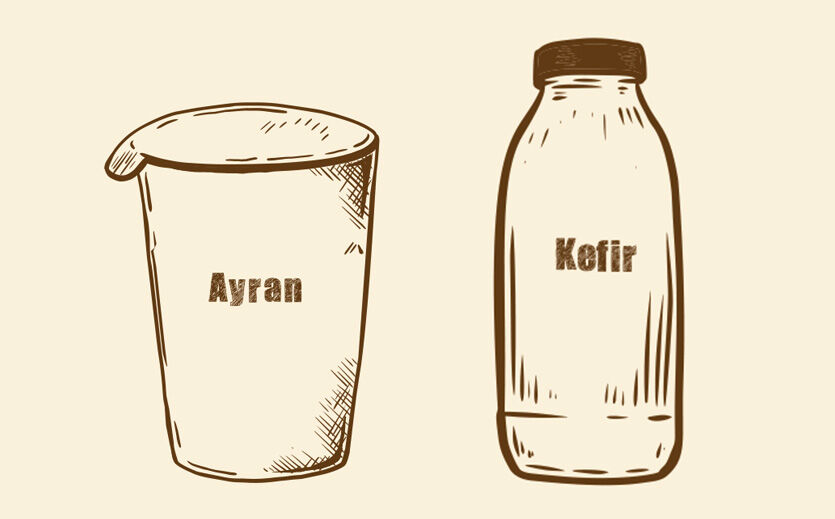Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt sank nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,2 Prozent.
Brand: Viele Belastungen stehen Erholung im Weg
„Konjunkturelle und strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege“, erklärte Präsidentin Dr. Ruth Brand bei der Vorstellung der Zahlen in Berlin. Zu den Belastungsfaktoren zählten laut Brand die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft, hohe Energiekosten, ein erhöhtes Zinsniveau sowie unsichere wirtschaftliche Aussichten. Die preisbereinigte gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung ging im Jahr 2024 um 0,4 Prozent zurück.
Besonders stark betroffen war das Verarbeitende Gewerbe, dessen Bruttowertschöpfung um 3 Prozent zurückging. Vor allem der Maschinenbau und die Automobilindustrie produzierten deutlich weniger.
In den energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Metallindustrie blieb die Produktion auf niedrigem Niveau, nachdem sie 2023 infolge der stark gestiegenen Energiepreise erheblich zurückgegangen war.
Noch stärker schrumpfte das Baugewerbe mit einem Minus von 3,8 Prozent. Die hohen Baupreise und Zinsen führten insbesondere zu einem Rückgang im Wohnungsbau. Lediglich der Tiefbau verzeichnete durch die Modernisierung und den Neubau von Straßen, Bahnverkehrsstrecken und Leitungen ein Plus.
Dienstleister verzeichnen Wachstum
Die Dienstleistungsbereiche entwickelten sich dagegen insgesamt positiv und legten um 0,8 Prozent zu. Der Einzelhandel und die Anbieter von Verkehrsdienstleistungen verzeichneten Zuwächse, während der Kfz- und Großhandel sowie die Gastronomie weniger erwirtschafteten als im Vorjahr.
Der Bereich Information und Kommunikation setzte seinen Wachstumskurs mit einem Plus von 2,5 Prozent fort. Auch die staatlich geprägten Wirtschaftsbereiche wie öffentliche Verwaltung, Erziehung und Unterricht sowie das Gesundheitswesen wuchsen mit 1,6 Prozent deutlich.
Außenhandel verliert an Schwung
Die privaten Konsumausgaben stiegen nur schwach um 0,3 Prozent. Trotz der sich abschwächenden Teuerung und Lohnerhöhungen blieb die Kauflaune gedämpft. Während die Ausgaben für Gesundheit um 2,8 Prozent und im Bereich Verkehr um 2,1 Prozent zulegten, gaben die privaten Haushalte deutlich weniger für Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen aus. Die staatlichen Konsumausgaben erhöhten sich dagegen um 2,6 Prozent, vor allem wegen gestiegener sozialer Sachleistungen.
Die Bruttoanlageinvestitionen sanken um 2,8 Prozent. Besonders die Bauinvestitionen gingen um 3,5 Prozent zurück, wobei der Wohnungsbau bereits das vierte Jahr in Folge schrumpfte. Die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen, Geräte und Fahrzeuge fielen mit minus 5,5 Prozent noch stärker.
Die Exporte von Waren und Dienstleistungen sanken um 0,8 Prozent, vor allem wegen geringerer Ausfuhren von elektrischen Ausrüstungen, Maschinen und Kraftfahrzeugen. Die Importe legten dagegen leicht um 0,2 Prozent zu, getragen von stärkeren Dienstleistungseinfuhren.
Beschäftigungsaufbau verlor an Dynamik
Die Erwerbstätigenzahl erreichte mit 46,1 Millionen Menschen zwar einen neuen Höchststand. Der Beschäftigungsaufbau verlor aber deutlich an Dynamik und kam zum Jahresende zum Erliegen.
Die staatlichen Haushalte verzeichneten nach vorläufigen Berechnungen ein Finanzierungsdefizit von 113 Milliarden Euro – rund 5,5 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Die Defizitquote lag mit 2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aber weiterhin unter der Drei-Prozent-Marke des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts.
Während Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen höhere Defizite aufwiesen, konnte der Bund sein Minus verringern, auch weil die Maßnahmen zur Abmilderung der Energiekrise Ende 2023 ausgelaufen waren.